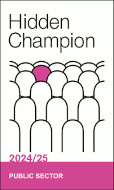| | Blickpunkt PD – März 2019 |  |
| | Sehr geehrte Damen und Herren, | | das Land Sachsen-Anhalt ist im Februar als neuntes Bundesland Gesellschafter der PD geworden. Unser Gesellschafterkreis hat sich – zusammen mit den gleichfalls neuen Gesellschaftern Rheinberg und Waren (Müritz) – damit auf 76 Anteilseigner (inklusive der mittelbaren Gesellschafter) erweitert. Wir freuen uns, mit diesem größer werdenden Gesellschafterkreis der öffentlichen Hand bei Projekten nachhaltiger Infrastruktur und moderner Verwaltungsarbeit zusammen arbeiten zu können. Die Verzahnung unseres Wissens nicht nur bei den Vorhaben für unsere Gesellschafter, sondern auch im Spiegel der Wissenschaft hat für uns eine besondere Bedeutung. Aus diesem Grund sind wir jetzt Mitglied im Partnerkreis der Universität Potsdam geworden. Dort werden wir den Wissenstransfer zwischen Forschung und Wirtschaft fördern und Studierenden der Verwaltungswissenschaft einen vertieften Einblick in die Projektarbeit eines öffentlichen Beratungsunternehmens geben. Wie die Zusammenarbeit unterschiedlicher Anspruchsgruppen bei einer anstehenden Zukunftsentscheidung zur Digitalisierung funktionieren kann, zeigen wir heute anhand unseres Praxisbeispiels aus dem Landkreis Karlsruhe. Wir haben diesen bei seinem Vorhaben begleitet, die digitalen Weichenstellungen für die Verwaltungsarbeit von morgen gemeinsam mit Bürgern, Wirtschaft und Verwaltungsmitarbeitern zu stellen. Für uns ist dieses Projekt ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Folgen der fortschreitenden Digitalisierung der Verwaltung offen diskutiert werden und der Weg für neue Maßnahmen partizipativ und integrierend gestaltet werden kann. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Fragen! Ihr Stéphane Beemelmans und Ihr Claus Wechselmann |
 |
| | Gemeinsam gestalten: Digitaler Landkreis Karlsruhe | | | | Der Landkreis Karlsruhe möchte die (digitale) Zukunft des Landkreises gemeinsam mit der Bürgerschaft, den Unternehmen, Lehrkräften, Verwaltungsmitarbeitern sowie den Bürgermeistern der Kommunen im Landkreis gestalten. Zur Unterstützung dieses partizipativen Ansatzes hat sich der Landkreis für mehrere Online-Umfragen und Workshops mit den verschiedenen Stakeholder-Gruppen entschieden. Dabei wurden zentrale Fragen der Digitalisierung diskutiert: Wie soll die Verwaltung zukünftig arbeiten? Wie soll gelehrt und gelernt werden? Wie kann die Digitalisierung den ÖPNV auch im ländlichen Raum stärken? Wie sieht die Gesundheitsversorgung der Zukunft aus? Im Mittelpunkt stand eine umfangreiche Online-Umfrage im September 2018 unter allen Bürger des Landkreises. Unter anderem warb der Kreiskämmerer in einem Interview für das Vorhaben. Die insgesamt 447 teilnehmenden Bürger beantworteten wahlweise Fragen aus den Gebieten Verwaltung, ÖPNV, Gesundheit und Pflege, Bildung sowie digitale Infrastruktur. Sie konnten ihre Erwartungen und Sorgen äußern und fallweise Einschätzungen kommentieren. Im Auftrag des Landkreises führte die PD die Umfrage und ihre Auswertung durch und bereitete die Ergebnisse für die interne wie externe Kommunikation auf. Trotzdem die Ergebnisse nicht repräsentativ waren, liefern sie zusammen mit den Resultanten der weiteren Maßnahmen wichtige Impulse für die Diskussion im Landkreis Karlsruhe um die digitale Zukunft. Möchten Sie mehr erfahren, sprechen Sie uns gern an. |
| | Die PD ist Mitglied im Partnerkreis „Industrie & Wirtschaft“ der Universität Potsdam | | | | Die PD kooperiert künftig eng mit der Universität Potsdam. Als Partner im universitären Kreis „Industrie & Wirtschaft“ wird sie Studierenden der Verwaltungswissenschaft in Vorlesungen und Seminaren sowie durch die Mitarbeit in laufenden Beratungsprojekten einen Einblick in die Beratungsbedarfe der öffentlichen Hand geben. Ziel ist es, auch mit dieser Kooperation den akademischen Austausch zu fördern und für eine zukunftsorientierte Projektarbeit die Beratungspraxis und Wissenschaft enger zu verzahnen. Bereits seit Dezember 2017 arbeitet die PD mit der in Berlin ansässigen Hertie School of Governance zusammen. Im Rahmen dessen fand im letzten Jahr die erste gemeinsame „PD-SummerSchool“ statt, bei der Führungskräfte der öffentlichen Hand über „Digitalisierung“ und deren Einfluss auf die Verwaltungsarbeit diskutierten. Zum Wintersemester 2018/2019 hat die Hertie School of Governance die Verwaltungswissenschaftlerin Dr. Thurid Hustedt als Professorin für „Public Administration and Management“ berufen. Die PD fördert diese Professur über einen Zeitraum von fünf Jahren an der staatlich anerkannten, privaten Universität. Dr. Thurid Hustedt befasst sich vorwiegend mit dem Verhältnis von Politik und Verwaltung, mit Reformen des öffentlichen Sektors und vergleichender Verwaltungsforschung. |
| | Als neuntes Bundesland: Sachsen-Anhalt ist Gesellschafter der PD | | | | Seit Februar 2019 ist das Land Sachsen-Anhalt Gesellschafter der PD. Es ist nach dem Gründungsgesellschafter Mecklenburg-Vorpommern das zweite im Osten Deutschlands gelegene Bundesland, das sich zum Anteilserwerb an der PD entschieden hat. Weitere Landesgesellschafter sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, die Freie Hansestadt Bremen und die Freie und Hansestadt Hamburg. Auch zwei Kommunen erweitern den auf 76 (direkte und mittelbare) Gesellschafter gewachsenen Kreis: die Städte Rheinberg in Nordrhein-Westfalen und Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern. Die PD berät die Stadt Waren bei einem für den städtischen Tourismus wichtigen Bauvorhaben: Auf Grundlage einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der PD hat sich die Kommune entschieden, einen neuen Fahrgasthafen zu bauen. |
| | Kurz notiert – PD öffentlich | | | | Die „5. Jahrestagung Öffentliches Bauen“ am 2. April 2019 in Frankfurt am Main stellt Konsequenzen und Lösungsansätze zur fachlichen Auseinandersetzung mit den gegenläufigen Bevölkerungsentwicklungen in Stadt und Land und den damit verbundenen Anforderungen an die örtliche Infrastruktur vor und möchte eine vertiefende Diskussion durch verschiedene Workshops ermöglichen. Die PD empfängt an ihrem Stand Gesellschafter, Kunden und Interessenten und informiert über das breit gefächerte Beratungsangebot der PD für Bau- und Infrastrukturvorhaben. Die Digitalisierung verändert die Lebensrealität aller Bürger unaufhörlich. Mit der Online-Umfrage „Digitaler Landkreis Karlsruhe“ sollten Bürger, Unternehmen und Verwaltungsbeschäftigte die Gelegenheit erhalten, die Digitalisierungsvorhaben der Karlsruher Kreisverwaltung mitzugestalten. Über die Beratung der PD für den Landkreis Karlsruhe informieren wir in einer Projektreferenz auf unserer Webseite und gerne auch im persönlichen Gespräch. |
| | | //aus Politik und Verwaltung// Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und die Kommunen wollen enger kooperieren. Ziel ist es, möglichst schnell bundeseigene Flächen für den kommunalen Wohnungsbau bereitzustellen. Die BImA sowie der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund erläutern in einem Informationsschreiben an die Kommunen ihr Vorhaben. So können Kommunen oder kommunale Wohnungsbauunternehmen die für Bundeszwecke entbehrlichen Flächen der BImA erwerben und darauf neuen Wohnraum schaffen oder gemeinsam mit der BImA Projekte realisieren. Für Kommunen bietet die Offensive der BImA die Möglichkeit, mit ihren Wohnungsbaugesellschaften bezahlbare und attraktive Quartiere zu schaffen und sich dadurch vom renditeorientierten Wohnungsmarkt abzugrenzen. Darüber hinaus plant die BImA, eigene Wohnungsbauvorhaben im Rahmen der Wohnungsfürsorge für die Unterbringung von Beschäftigten des Bundes umzusetzen und dadurch ebenfalls zu einer Entlastung angespannter Wohnungsmärkte beizutragen. Bereits heute verfügt die BImA mit rund 36.200 Wohneinheiten über einen namhaften Wohnungsbestand. Die PD berät die BImA, die seit 2017 Gesellschafter der PD ist, in laufenden Modernisierungsprojekten ihrer bundesweiten Liegenschaften. //aus Wissenschaft und Forschung// In der Studie „Exekutive KI 2030 – Vier Zukunftsszenarien für Künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung“ untersucht das „Kompetenzzentrum Öffentliche IT“ von Fraunhofer FOKUS, wie der KI-Einsatz in der Verwaltung der Zukunft aussehen kann. Im ersten Szenario ist der Staat selbst wichtigster Nutzer und Forschungstreiber eines intensiven Einsatzes von KI in der Verwaltungsarbeit. In den drei weiteren Szenarien wendet der Staat KI-Systeme „von der Stange“ an oder nutzt KI kaum bzw. nur gegen den technikkritischen Willen der Bevölkerung. Die Studienautoren möchten mit ihren Szenarien zeigen, dass der Einzug von KI-Systemen in die öffentliche Verwaltung keineswegs selbstverständlich ist. Vielmehr bestehe vielfältiger politischer Gestaltungsbedarf, um die Bevölkerung und die Verwaltungsbeschäftigten für den KI-Einsatz zu begeistern. Auch sollte die Politik für eine hinreichende Datenverfügbarkeit zum Training der KI-Systeme sorgen und eigene, auf dem freien Markt begehrte Fachkräfte vorhalten, deren Expertise die Qualität und IT-Sicherheit der Systeme garantierten. Die Frage nach dem KI-Einsatz wird so auch stark zu einer Frage der Personalpolitik und -entwicklung in der öffentlichen Verwaltung. Davor gilt es allerdings die Frage zu beantworten, wie viel KI in welchen Bereichen überhaupt gewünscht ist. //aus Wissenschaft und Forschung// Wie der Fachkräftebedarf in Deutschland auch zukünftig gedeckt werden kann, ist ein breit diskutiertes Thema. Denn bis zum Jahr 2060 braucht Deutschland pro Jahr 260.000 zusätzliche Fachkräfte aus dem Ausland: Das ist das Ergebnis der Studie „Zuwanderung und Digitalisierung“ im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Die Mehrheit dieser Fachkräfte müsste aus Ländern außerhalb der EU nach Deutschland kommen – aber auch besonders betreut werden. Hauptursache für den hohen Fachkräftebedarf sei der demografische Wandel: Die Deutschen werden im Schnitt immer älter und bekommen gleichzeitig weniger Kinder. Genauso geht es vielen anderen Ländern der EU. Die Studienautoren erwarten daher, dass immer weniger Fachkräfte aus anderen Ländern Europas nach Deutschland kommen, weil sie in ihren Heimatländern gebraucht und gut bezahlt werden. Deshalb müssten die meisten der benötigten ausländischen Fachkräfte aus sogenannten Drittländern stammen: Jährlich knapp unter 150.000, beispielsweise aus Indien, China oder Russland. Um freie Stellen in Deutschland zu besetzen, müssten zudem die Kinderbetreuung verbessert und Langzeitarbeitslose besser qualifiziert werden. |
| | | Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. |
| | Mit-Arbeit – Stellenausschreibungen | | | | Wir suchen Consultants, Praktikanten, Werkstudenten und Manager für unsere Teams Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau / Infrastruktur. Besuchen Sie unsere Karriereseite! |
Eine Auswahl aktueller Stellenanzeigen finden Sie hier: |
 | Herausgeberin
PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
Friedrichstraße 149, 10117 Berlin
Kontakt
Anja Tannhäuser
anja.tannhaeuser@pd-g.de
T +49 30 257679-139
Inhaltlich verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV
Stéphane Beemelmans und Claus Wechselmann
c/o PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH, Friedrichstr. 149, 10117 Berlin | 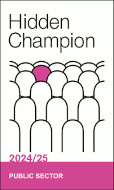 | | | pd-g.de/ |
|