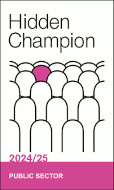|
| Blickpunkt PD – April 2020 |
 |
| Sehr geehrte Damen und Herren, die Ausbreitung des Corona-Virus in Deutschland und der Welt verdeutlicht, wie wichtig eine Verwaltung ist, die auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleibt und wirksame Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und der Wirtschaft ergreift. Dabei beschleunigt die aktuelle Situation den Wandel der Arbeitswelt. Verwaltungen erproben neue Formen der dezentralen, virtuellen Zusammenarbeit. Wir selbst haben das Arbeitsleben gleichfalls umorganisiert, der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter arbeitet nun mobil im Homeoffice. Unsere Projekte können damit fast uneingeschränkt weiterlaufen. Von unseren Erfahrungen und den Empfehlungen unserer Experten der „Organisationsentwicklung“ zur Arbeit im Homeoffice möchten wir Ihnen gern heute berichten. Angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen die öffentliche Verwaltung derzeit steht, möchten wir neben dem Agieren mit Augenmaß zu einer strategischen Herangehensweise auf organisatorischer, funktionaler und fachlicher Ebene ermutigen. Auch kleine Vorhaben haben die Chance, bei einer Prüfung der Rahmenbedingungen, Ziele und Handlungsoptionen nachhaltige Wirkung zu entfalten. Lesen Sie nachfolgend darüber, wie Strategien zu einer größeren Aktionsfähigkeit selbst in Krisen beitragen können. In unserem heutigen Newsletter schreiben wir auch über die Begleitung eines Pflegeheim-Neubaus in Nürnberg, der nun – begleitet von der PD – starten kann. Ein vierter Beitrag beschäftigt sich mit der kommunalen IT-Strategie. In der aktuellen Zeit der intensiven digitalen Nutzung gleichfalls ein akutes Thema. Wir wünschen Ihnen Gesundheit und ein gutes Gelingen Ihrer Vorhaben. Über Feedback, Fragen oder Wünsche freuen wir uns! Ihr Stéphane Beemelmans und Ihr Claus Wechselmann |
 |
| ||||
| Als Unternehmen der öffentlichen Hand stehen wir unseren öffentlichen Kunden und Eigentümern auch während der Corona-Krise zur Seite. In der Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern nutzen wir bereits erfolgreich unterschiedliche digitale Formate, Anwendungen und Kollaborationsplattformen. Wir beraten Sie gern zu Lösungen, die den Fortgang der Verwaltungsarbeit sicherstellen. Zahlreiche Beschäftigte arbeiten bereits aus dem „Homeoffice“ und erleben die Vorzüge wie auch die Eigenheiten des Arbeitens vom heimischen Schreibtisch aus. Führungskräfte und Beschäftigte stehen vor der Herausforderung, die virtuelle Zusammenarbeit zu organisieren und den eigenen Arbeitsalltag zu strukturieren. Aktuell haben wir für Sie einige Anregungen zusammengestellt, worauf Sie bei der Arbeit aus dem Homeoffice achten sollten. Das können unter anderem Strategien zur effektiven Aufgabenplanung und zum konzentrierten Arbeiten sein, die es auch ermöglichen, die Betreuung der Kinder oder die Erledigung häuslicher Pflichten miteinander zu verbinden. |
| ||||
| Technologische, gesellschaftliche und ökonomische Entwicklungen stellen neue Anforderungen an die Rolle und Leistungserbringung der öffentlichen Hand. Der politische Raum erwartet von Verwaltungen, innerhalb ihres Gestaltungsspielraums zu Treibern des gesellschaftlichen Wandels zu werden. Proaktiv handelnde und in Szenarien denkende öffentliche Institutionen gewinnen insbesondere angesichts der aktuellen Krisensituation an Bedeutung. Strategien auf organisatorischer, funktionaler und fachlicher Ebene befähigen öffentliche Einrichtungen zu zielgerichtetem Handeln, nachhaltigem Wandel und machen sie zukunftsfähig. Die Berater der PD arbeiten direkt mit den Leitungsebenen öffentlicher Institutionen zusammen und beraten diese als Partner in Bezug auf strategische Lösungsansätze. So hat die PD beispielsweise eine bundesweit aktive Anstalt öffentlichen Rechts bei der Konzeption einer Gesamtstrategie begleitet. Die PD erarbeitete gemeinsam mit dem Auftraggeber einen auf den spezifischen Kontext der Organisation zugeschnittenen Strategieansatz. Die Ausarbeitung beinhaltete zunächst die Analyse der Organisation und der für die Auftragserfüllung relevanten Rahmenbedingungen, die Identifikation der wesentlichen Treiber, die Entwicklung einer Vision und strategischer Ziele durch die Vorstandsebene sowie die Erarbeitung von strategisch sinnvollen Initiativen und Maßnahmen in Workshops mit der erweiterten Leitungsebene. Die eigenverantwortliche Umsetzung der Strategie durch den Kunden unterstützte die PD durch ein Umsetzungs-Coaching. Strategische Beratung für öffentliche Institutionen bedeutet, heute die Weichen zu stellen, damit Verwaltungen ihren gesetzlichen Auftrag gegenüber Parlament, Bürgern und Unternehmen – auch in Zukunft – nachhaltig erfüllen können. Wir begleiten Sie gerne auf dem Weg, Ihre Organisation strategisch aufzustellen! |
| ||||
| In der Stadt Nürnberg werden unterschiedliche Pflegeangebote an verschiedenen Standorten über einen Eigenbetrieb, den NürnbergStift, organisiert. Eines der Pflegeheime, das „August-Meier-Haus“, weist einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Die Sanierung stellt jedoch keine wirtschaftlich vertretbare Option dar. Zudem besteht in Nürnberg Bedarf an zusätzlichen Pflegeplätzen. Auf dieser Grundlage fiel die Entscheidung, einen nachhaltigen Neubau zu errichten und dieses Projekt im Rahmen eines Partnerschaftsmodells (sog. Inhabermodell) umzusetzen. Im Februar 2020 konnte das Vergabeverfahren nun erfolgreich mit der Zuschlagserteilung an einen privaten Partner abgeschlossen werden. Die PD begleitet das Projekt seit 2017 als wirtschaftlicher Berater und Projektmanager. Für das NürnbergStift hat die PD ein innovatives Lebenszyklusmodell entwickelt, das Planung, Neubau, Finanzierung und ausgewählte Gebäudedienstleistungen über eine Laufzeit von 25 Jahren in einer gebündelten Vergabe umfasst. Das Projekt finanziert sich unter anderem durch ein im Vergabeverfahren aufgestelltes Förderprogramm des Freistaats Bayern, ein KfW-Programm sowie durch Stiftungsmittel. Auch während der Projektumsetzung wird die PD die Stadt Nürnberg als Projektmanager unterstützen. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an uns. |
| ||||
| Die Digitalisierung eröffnet Kommunalverwaltungen vielfältige Chancen, näher am Bürger zu arbeiten und interne Prozesse zu optimieren. Voraussetzung hierfür ist eine leistungsfähige IT-Organisation in den Kommunen. Mit einer modernen IT-Strategie verbessern Verwaltungen die IT-Steuerung, definieren die machbare und sinnvolle Fertigungstiefe der IT und setzen Ziele und Rahmenbedingungen für IT-Kooperationen. Kommunale IT-Leistungen sollen die politischen Ziele der Verwaltung unterstützen und eine fortlaufende Modernisierung ermöglichen. Bei der Entwicklung der IT-Strategie wird die bestehende Organisationsstrategie einbezogen, um die Leistungserbringung der IT am Unterstützungsbedarf der Verwaltungseinheiten auszurichten. Die technologischen Möglichkeiten und die rechtlichen Anforderungen, die sich beispielsweise aus dem Onlinezugangsgesetz ergeben, werden berücksichtigt. Anschließend werden entsprechede Maßnahmen für die IT-Organisation abgeleitet. Die PD unterstützt Kommunen bei der Konzeption und Realisierung ihrer IT-Strategie. Ausgangspunkte sind eine gemeinsame Analyse des Ist-Zustands und die Entwicklung eines verwaltungspolitischen Zielbildes für die IT, das den Fahrplan für die schrittweise Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen vorgibt. Mit der kommunalen IT-Strategie schaffen Verwaltungen einen Rahmen, den Bürgern, Unternehmen und ihren Beschäftigten moderne IT-Dienstleistungen anzubieten. Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an! |
| ||||
| //aus der Verwaltung// Die Europäische Kommission möchte Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen und dabei gleichzeitig das wirtschaftliche Wachstum fördern. Damit dies gelingt, sollen smarte Technologien zum Einsatz kommen. In die Programme zur Digitalisierung will die Europäische Kommission rund 17,5 Milliarden Euro investieren. Unter anderem sollen Rechenzentren und die Telekommunikationsbranche verstärkt erneuerbare Quellen nutzen, um energieeffizienter und bis 2030 klimaneutral zu werden. Die Kommission stellt hierfür in ihrem „Weissbuch zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen“ Vorschläge für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz zur Diskussion. Der private und der öffentliche Sektor sollen gemeinsam Ressourcen entlang der gesamten Wertschöpfungskette mobilisieren und die richtigen Anreize schaffen, damit auch kleine und mittlere Unternehmen KI-Lösungen schneller nutzen können. Für risikoreiche KI-Systeme sieht die Europäische Kommission klare Regeln vor. So sollen die Vorschriften für den Verbraucherschutz sowie der Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre erhalten bleiben. In Fällen mit hohem Risiko, wie beispielsweise im Gesundheitssektor, bei der Polizei oder im Verkehr, sollten KI-Systeme transparent und rückverfolgbar sein. Die Aufsicht durch den Menschen soll hierbei stets gewährleistet sein. Behörden sollten die von Algorithmen genutzten Daten prüfen und zertifizieren können. Die PD berät derzeit Bundesbehörden dabei, KI-Technologien verantwortungsvoll, das heißt im Sinne der Bürger, einzusetzen. Die Beratung umfasst verschiedene Machbarkeitsstudien sowie die Konzeption und den Test von Prototypen. Ziel ist es jeweils, die umfangreichen Datenbestände der Behörden nach bestimmten Kriterien auszuwerten und dadurch Verwaltungsabläufe zu beschleunigen. //aus der Verwaltung// In deutschen Ballungsgebieten herrscht Wohnungsmangel. Der Bund könnte mit der Initiative „Zukunft Wohnen“ den öffentlichen Wohnungsbau ankurbeln, empfiehlt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). In der Studie „Wege aus der Wohnungskrise“ schlägt das IMK die Gründung von drei Gesellschaften des Bundes vor, die Länder und Kommunen beim Wohnungsbau unterstützen: „eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an kommunalen Wohnbauunternehmen mit Eigenkapital beteiligt, einem Bodenfonds und einer Beratungsgesellschaft, die Städten und Gemeinden Planungskapazitäten zur Verfügung stellt“. Die Beratungsgesellschaft „Zukunft Wohnen“ könnte nach Auffassung des IMK an die PD angegliedert werden. Die PD begleitet im Rahmen des „Investitionsberatungsauftrags des Bundes“ bereits erfolgreich zahlreiche Kommunen bei der Entwicklung von Strategien für den öffentlichen Wohnungsbau. Dies beinhaltet die Organisationsentwicklung und -umsetzung sowie die Realisierung von Wohnungs- und Quartiersvorhaben. Der Fokus liegt dabei auf einer lebenszyklusorientierten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Umsetzung. Die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft kann dabei ein geeignetes Mittel sein, eine nachhaltige Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik umzusetzen, wie ein Blick auf die Stadt Monheim am Rhein zeigt. //aus Wissenschaft und Forschung// Der diesjährige Digitalisierungsindex der „Initiative D21“ zeichnet ein durchwachsenes Bild der digitalen Entwicklung in Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahresindex ist der Digitalisierungsgrad innerhalb der deutschen Bevölkerung von 55 auf lediglich 58 von 100 möglichen Punkten gestiegen. Allerdings seien inzwischen 86 Prozent der deutschen Bevölkerung online, was einem Zuwachs von zwei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspräche. Dabei zeige sich vor allem das mobile Internet als Treiber, das inzwischen von 74 Prozent der Bevölkerung genutzt würde. Jedoch zeigt sich, dass Menschen mit niedriger Bildung nur zu 64 Prozent online waren, während Menschen mit hoher Bildung im Betrachtungszeitraum bis zu 90 Prozent Online-Zeiten hatten. Angesichts der derzeitigen Krise verändert sich sowohl im Ausmaß als auch in der Schnelligkeit massiv die Art, wie Dienste und Angebote des täglichen Lebens gestaltet und zugänglich gemacht werden. Ein digitaler Zugang zu Wissen, Informationen und Diensten ist inzwischen Standard. Auch im Arbeitsleben selbst spielen Kenntnisse zur Digitalisierung eine immer größere Rolle. Die Autoren der Studie warnen daher davor, dass gering Gebildete Gefahr laufen, dauerhaft von gesellschaftlicher Teilhabe und Mitgestaltung ausgeschlossen zu werden. In der aktuellen Situation kommt noch die technische Verfügbarkeit zu digitalen Angeboten als Herausforderung für ärmere Bevölkerungsschichten hinzu. |
| ||||
| Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. |
| ||||
| Wir suchen Consultants, Praktikanten, Werkstudenten und Manager für unsere Teams Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung. Besuchen Sie unsere Karriereseite! |
Team Strategische Verwaltungsmodernisierung (Auswahl) |
Team Bau, Infrastruktur, Kommunalberatung (Auswahl) |
 | ||
| ||
|